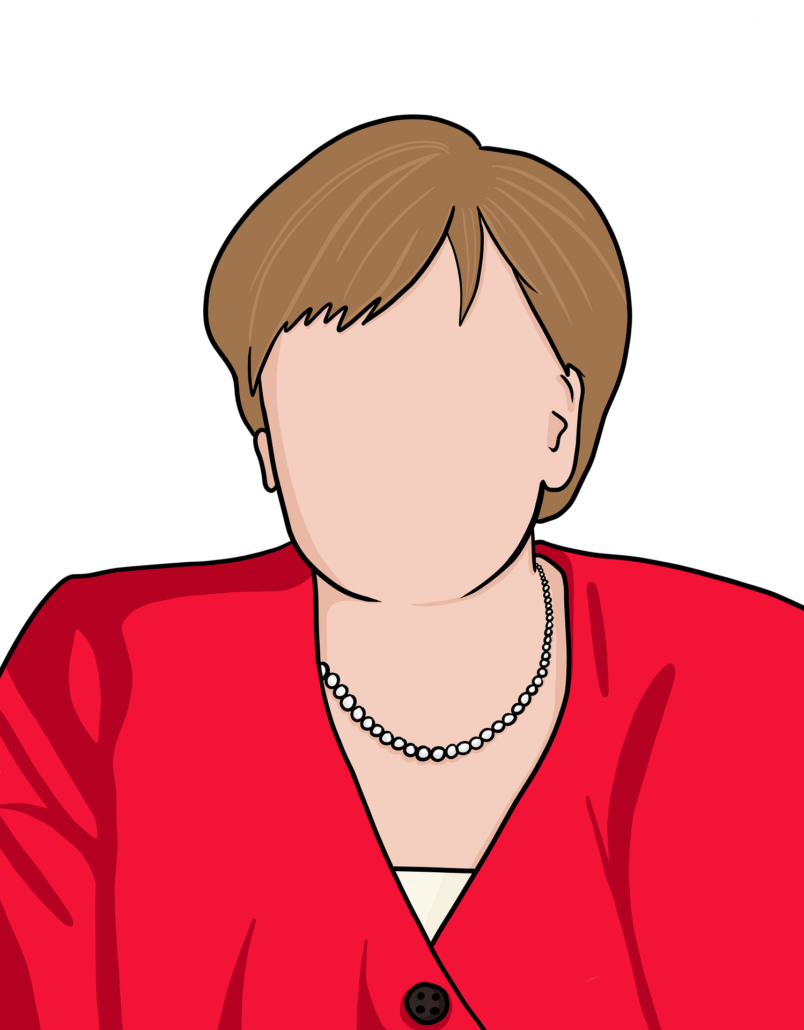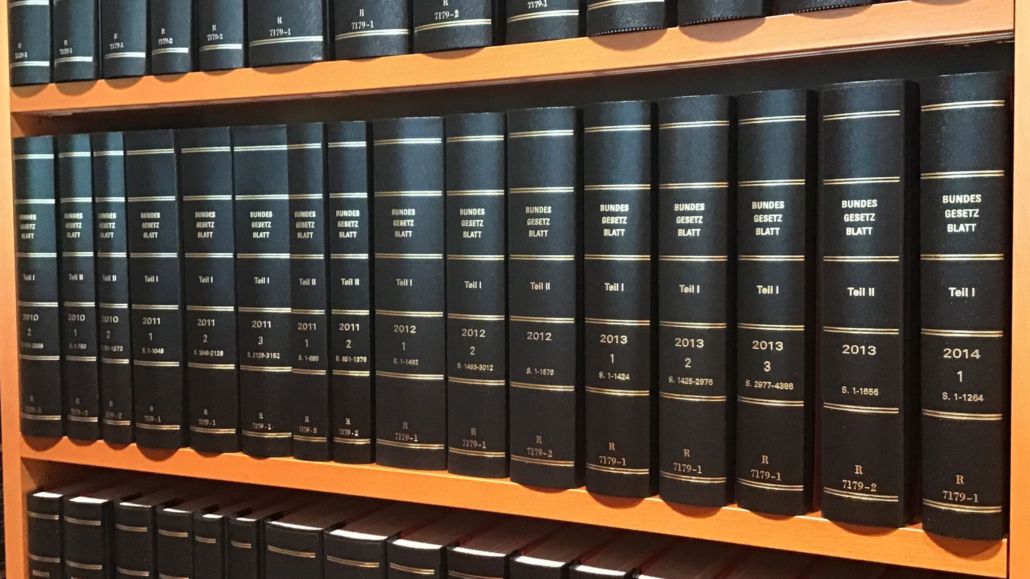Für diese Legislatur ist das mein letzter Videoreport zum Digitalausschuss, daher ist er auch etwas länger geraten. Als Gäste war Bundesinnenminister Seehofer da, sowie Dr. Markus Richter, CIO des Bundes und CIO des BMI, und Harald Joos, CIO des Bundesministerium der Finanzen.
Seehofer lobhudelte zur Digitalisierung in Deutschland und verblüffte den Digitalausschuss mit der Aussage, ein künftiges Digitalministerium hätte gar nicht mehr viel zu tun, selbst der Breitbandausbau sei ja quasi schon so gut wie beendet. Ich löcherte ihn mit Fragen zum Staatstrojaner, zum (fehlenden) Lagebild für Gewalt gegen Frauen, zur Strategie des BMI im Umgang mit Bedrohungslagen durch Ransomware und ich befragte ihn zum barrierefreien Notruf und erzählte von der sehr negativen Erfahrung von Julia Probst, auf Twitter @EinAugenschmaus, bei einem Notruf mit Gebärdendolmetscherin in einer Videoschalte.
Bei den beiden CIOs ging es um Maßnahmen, die digitale Souveränität der Verwaltung zu verbessern, da ging es erfreulich viel um Open Source, vom Verwaltungs-OSS-Arbeitsplatz bis zu einem nationalen Open Source Hyperscaler – eine quasi „TÜV-geprüfte“ Cloud, die vom BSI und vom BfDI für vertrauenswürdig und sicher befunden wurde und von allen Verwaltungen – von Bund bis zur Kommune genutzt werden könnte. Spannend klang das. Aber kommt es auch? Am Ende ging es auch noch mal ums Onlinezugangsgesetz, hier habe ich auch auf einige Eurer Fragen Antworten erhalten können.
Weiterlesen