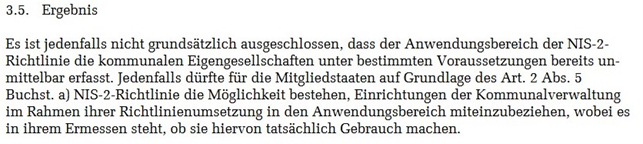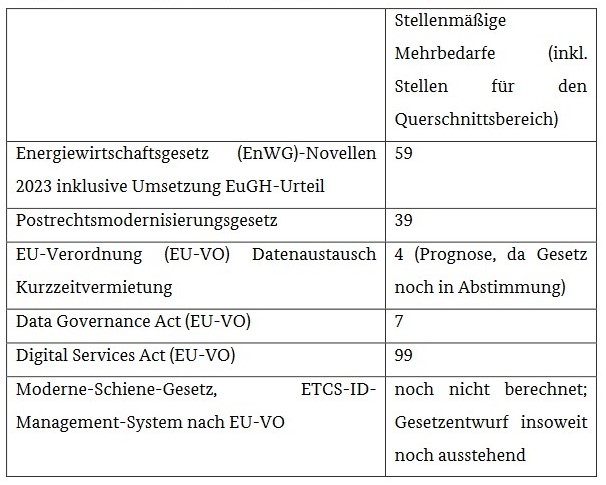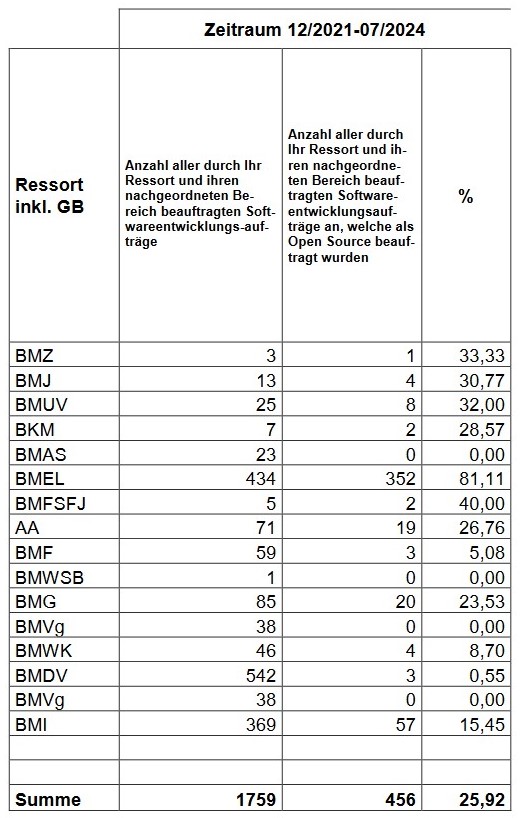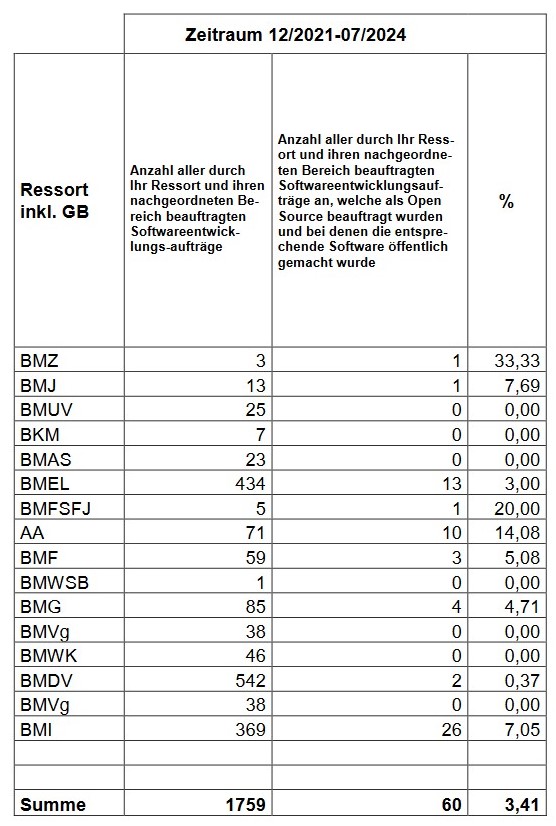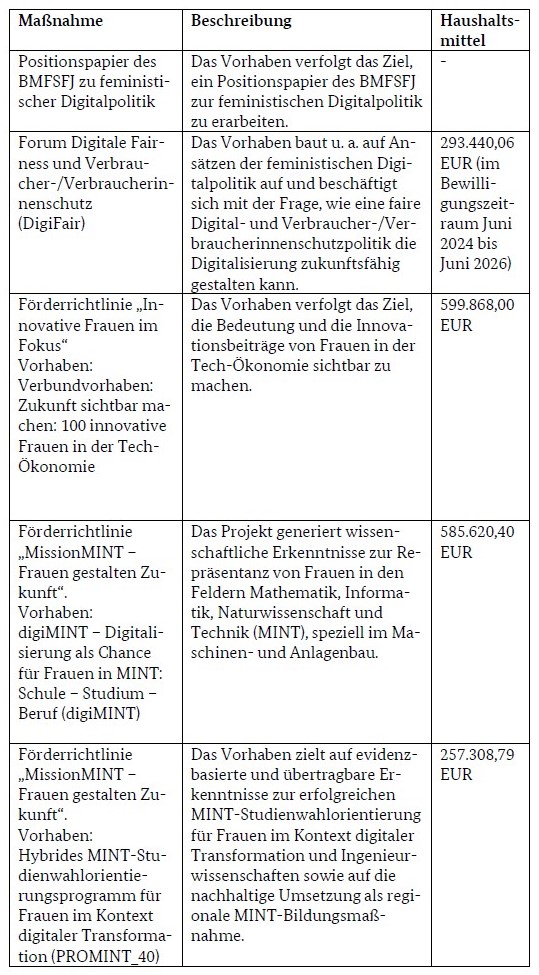Frage:
Wie bewertet die Bundesregierung den Umstand, dass nach Aussage des Leiters der Abteilung Secure Software Engineering, der die von der gematik GmbH beim Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie SIT (Fraunhofer SIT) in Auftrag gegebene Sicherheitsstudie zum ePA System betreut hat, die gematik als Auftraggeberin entschieden hat, fremdstaatliche Akteure wegen fehlender Relevanz nicht in die Sicherheitsbetrachtung einzubeziehen, obwohl das Fraunhofer SIT in eben dieser Studie selbst angibt, dass fremdstaatliche Akteure sowohl über hohe finanzielle, als auch über hohe technische Ressourcen verfügen und daher mit „hoher Relevanz“ zu bewerten wären (vgl. Sicherheitsanalyse des Gesamtsystems ePA für alle, www.gematik.de/media/gematik/Medien/ePA_fuer_alle/Abschlussbericht_Sicherheitsana-
lyse_ePA_fuer_alle_Frauenhofer_SIT.pdf, S. 22 und www.zeit.de/digital/datenschutz/2024-12/elektronische-patientenakte-it-sicherheit-datenschutz-geheimdienste), und würden die Bundesregierung und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor diesem Hintergrund auch Geheimnisträgerinnen und Geheimnisträgern, vor allem solchen mit besonders sensiblen Gesundheitsinformationen, die Nutzung der elektronischen Patientenakte 3.0 angesichts der bestehenden Risikolage mit hybrider Kriegsführung, u. a. durch staatliche Akteure aus Russland, zum Zeitpunkt ihrer Einführung empfehlen?
Antwort:
Fremdstaatliche Akteure und deren Angriffsvektoren werden sowohl im Gutachten vom Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie als auch in den Sicherheitsanalysen der gematik berücksichtigt. Den im Bereich der Telematikinfrastruktur bestehenden Bedrohungen wird bereits wirkungsvoll entgegengewirkt. Technisch werden derzeit weitere Sicherheitskomponenten eingebaut, die internationalen Angreifern das massenhafte Abgreifen von Daten unmöglich machen. Im europäischen Vergleich verfügt Deutschland damit über eine der sichersten Infrastrukturen im Gesundheitswesen überhaupt, welche unter Einbeziehung der
obersten Sicherheits- und Datenschutzbehörden konzipiert wurden.
Frage:
Wie plant die Bundesregierung bis zur Einführung der elektronischen Patientenakte 3.0 („ePA für alle“) alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger analog zu Beipackzetteln von Medikamenten so über Risiken und Einschränkungen in den Funktionen und für die informationelle Selbstbestimmung der ePA 3.0 zu informieren, dass diese eine tatsächlich informierte Entscheidung für oder gegen die Nutzung der ePA 3.0 treffen können, wie es der Verbraucherzentralen Bundesverband am 5. Dezember 2024 öffentlich forderte (www.vzbv.de/pressemitteilungen/elektronische-patientenakte-krankenkassen-informieren-unzureichend), und plant die Bundesregierung zu evaluieren, ob sich zum Zeitpunkt der Einführung der ePA 3.0 in der Opt-Out Variante die betroffenen Versicherten ausreichend informiert sehen (vgl. Insights-Bericht der Gematik „Status quo „ePA für alle“, Ein Stimmungsbild vor dem Rollout 2025“ vom 10. Dezember 2024, wonach noch im Oktober 2024 erst 34 Prozent der Bevölkerung laut einer repräsentativen Befragung angaben, ausreichend über die ePA für alle informiert zu sein und 41 Prozent der Befragten die ePA noch nicht einmal dem Namen nach kannten: www.gematik.de/telematikinfrastruktur/ti-atlas/einblicke/insights)?
Antwort:
Die Krankenkassen als Anbieter der elektronischen Patientenakte (ePA) sind gesetzlich verpflichtet, alle Versicherten umfassend sowie gemäß § 343 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu informieren, bevor eine ePA zur Verfügung gestellt wird. Die gesetzlich vorgesehenen Pflichtinformationen sollen allen Versicherten die Möglichkeit für eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und fundierte Entscheidung über die Nutzung der elektronischen Patientenakte bieten. Die Information aller gesetzlich Versicherten durch die Krankenkassen muss bis sechs Wochen vor der Einführung der ePA für alle, die am 15. Januar 2025 eingeführt wird, erfolgt sein. Die Überwachung und die Einhaltung der Vorgaben obliegt den zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass alle gesetzlich Versicherten informiert wurden und sich auch weiterhin bei ihren Krankenkassen informieren können.
Um alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Leistungserbringenden, möglichst gut zu informieren und auf die ePA vorzubereiten, ist am 30. September 2024 die Informations- und Fachkampagne des Bundesministeriums für Gesundheit gestartet. Aufgrund der bundesweiten Kampagne ist davon auszugehen, dass die Aufklärung und Information aller Versicherten weiter gesteigert werden konnte. Bis zum Start der ePA für alle am 15. Januar 2025, und auch darüber hinaus, wird die Bundesregierung weiterhin auf verschiedenen Wegen die Versicherten über die ePA für alle informieren.
Frage:
Welchen konkreten Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung nach dem Vortrag zu Sicherheitsrisiken bei der elektronischen Patientenakte (ePA) 3.0 auf dem 38C3 in Hamburg am 27. Dezember 2024 in Bezug auf diese Sicherheitsrisiken (bitte für jede/s genannte Risiko/Sicherheitslücke den jeweiligen Handlungsbedarf spezifizieren, bzw. mit nein antworten, wo es keinen gibt), und hält sie vor dem Hintergrund dieser Gesamtrisiken entweder eine Verschiebung der Einführung der ePA 3.0 für alle (mit Opt-out-Möglichkeit) oder einen Wechsel auf Einführung der ePA 3.0 nach dem bisher geltenden Freiwilligkeitsprinzip (Opt-In) zum aktuell geplanten Zeitpunkt für denkbare Szenarien (ggf. auch eine Kombination beider Szenarien), um die Folgen möglicher Sicherheitsrisiken für Nutzende der ePA für alle zu minimieren?
Antwort:
Die Bundesregierung nimmt die durch den Chaos Computer Club (CCC) veröffentlichten Hinweise zur Sicherheit der elektronischen Patientenakte (ePA) sehr ernst. Die vom CCC beschriebenen Probleme sind länger bekannt und werden gelöst. Darüber hat sich das BMG auch vor dem Chaos Communication Congress (38C3) mit dem CCC ausgetauscht. Das BMG und die gematik stehen insbesondere im intensiven Austausch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und es wurden bereits technische Lösungen zum Unterbinden der Angriffsszenarien konzipiert, deren Umsetzung jeweils rechtzeitig abgeschlossen sein wird. Für die ab 15. Januar 2025 startende Pilotphase bedeutet dies, dass zunächst nur die in der Modellregion teilnehmenden und explizit gelisteten Leistungserbringer („Whitelisting“) auf die ePA der Versicherten zugreifen können.
Vor dem bundesweiten Rollout bei den Leistungserbringern werden weitere technische Lösungen umgesetzt und abgeschlossen sein. Dazu gehört insbesondere, dass organisatorisch sowohl die Prozesse zur Herausgabe als auch zur Sperrung von Karten sowie technisch das VSDM++-Verfahren nachgeschärft werden. Gleichzeitig werden zusätzliche Überwachungsmaßnahmen wie Monitoring und Anomalie-Erkennung implementiert. Somit steht weder dem Start in den Modellregionen zum 15. Januar 2025 noch dem darauffolgenden bundesweiten Rollout nach Umsetzung der Maßnahmen etwas entgegen. Die ePA für alle kann sicher von Praxen, Krankenhäusern, Apotheken sowie Patientinnen und Patienten genutzt werden.
Frage:
Sind die von der gematik GmbH am 27. Dezember 2024 vorgeschlagenen Maßnahmen (vgl. www.gematik.de/newsroom/news-detail/aktuelles-stellungnahme-zum-ccc-vortrag-zur-epa-fuer-alle) aus Sicht des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geeignet, um ein der Sensibilität von Gesundheitsdaten angemessenes Sicherheitsniveau beim Betrieb der elektronischen Patientenakte 3.0 zu erreichen, also eine Ausnutzung der in einem Vortrag auf dem 38C3 (38. Chaos Communication Congress ) in Hamburg am 27. Dezember 2024 beschriebenen Sicherheitslücken, die sämtlich in der Praxis mit z. T. sehr geringem Aufwand von Sicherheitsforschenden ausgenutzt werden konnten, künftig zu verhindern, und welche konkreten Forderungen stellte ggf. die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit seit August
2024 bis 30. Dezember 2024 im Zusammenhang mit der Sicherheit der elektronischen Patientenakte 3.0 bezogen auf den Zeitpunkt ihrer Einführung an die Bundesregierung oder an die von ihr als Mehrheitsgesellschafterin kontrollierte gematik, nachdem die gematik und damit auch die Bundesregierung als ihre Mehrheitsgesellschafterin über diverse Sicherheitsrisiken informiert worden war?
Antwort:
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) war und ist eng in die Abstimmung mit der gematik eingebunden. Die von der gematik vorgeschlagenen Maßnahmen werden vom BSI als geeignet angesehen.
Von September bis Dezember 2024 fanden mehrere Termine zwischen der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), dem BSI und der gematik zur Bewertung des Risikos im Zusammenhang mit der dargestellten Schwachstelle statt. Hier wurde vornehmlich die Wirksamkeit der bereits getroffenen Maßnahmen sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit besprochen. Zusätzlich war die BfDI dauerhaft in die regelmäßige Abstimmung zum Sicherheitskonzept mit gematik und BSI eingebunden.
Antworten der Bundesregierung im Original (geschwärzt):