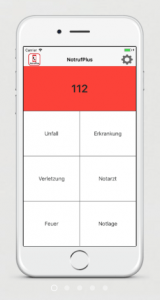Weil es durch die verlängerte Sperrung der Schleuse Zaaren zu einer für viele kleine und mittlere Unternehmen existenzbedrohenden Unterbrechung der Bundeswasserstraße von Berlin zur Mecklenburgischen Seenplatte mitten in der Hauptsaison für Tourismus und Wasserwirtschaft kommt, hat die Bundestagsabgeordnete, Anke Domscheit-Berg, das Bundesverkehrsministerium gefragt, was für Maßnahmen man dort plant, um die dramatischen Folgen für die regionale Wirtschaft zu mildern.
Nach Schätzungen der IHK Potsdam wird sich der finanzielle Schaden auf bis zu zwei Millionen Euro belaufen, was der Bundesregierung offenbar egal ist, denn ihre Antwort ist ein Monument der Ignoranz. So schreibt Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, „Die Schiffbarkeit einer Bundeswasserstraße ist eine faktische Gegebenheit, die den Schifffahrttreibenden Chancen zur Betätigung eröffnet, auf deren Fortbestand aber kein Anspruch besteht.“ Weiter heißt es, dass es bei Bundeswasserstraßen keinen „Anspruch auf Schaffung, Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Weges“ gibt.
Dazu Anke Domscheit-Berg, stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss: „Diese Antwort ist blanke Verhöhnung und zeigt, wie wenig der Bundesregierung ihr eigener Koalitionsvertrag wert ist, denn dort versprach sie noch, für die ausschließlich dem Tourismus oder Sport dienenden Nebenwasserstraßen des Bundes ’neue Prioritäten setzen‘ zu wollen. Vom Grundsatz ‚Eigentum verpflichtet‘ hält die Bundesregierung in der Praxis offenbar nichts und demonstriert ein weiteres Mal, wie wenig wichtig ihr gerade der Osten Deutschlands ist.“
Selbst ohne verpflichtendes Eigentum – immerhin geht es um Wasserstraßen, die dem Bund gehören – hätte der Bund wie bei der Dürre im Vorjahr finanzielle Nothilfen prüfen können, um gerade in einer strukturschwachen Region die Folgen ihrer eigenen jahrelangen Vernachlässigung der Pflege bundeseigener Infrastruktur zu mildern.
Anke Domscheit-Berg, die sowohl im Havelland als auch in Oberhavel Wahlkreisbüros unterhält, fordert unbürokratische Unterstützung für notleidende Betriebe, die von der Sperre existenziell betroffen sind und ergänzt: „Anstatt pragmatisch und zeitnah auf die um Hilfe bittenden kleinen und mittleren Betriebe zu reagieren, schleudert das Bundesverkehrsministerium ihnen faktisch entgegen, dass sie doch einfach dahin gehen sollen, wo zufällig Wasserstraßen schiffbar sind. Teure Umwege auf der Elbe können größere Schifffahrtunternehmen ja vielleicht noch erwägen, aber für Hausboote, Zeltplätze, Paddelbootverleihe und Schleusenrestaurants ist das leider keine Option. Mit organisierter Verantwortungslosigkeit nimmt der Bundesverkehrsminister das Aus für diese Unternehmen und die Gefährdung vieler Arbeitsplätze in Kauf.“
Quellen:
* Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1 Seite 82, Zeile 3807
* Antwort auf die Schriftliche Frage von Anke Domscheit-Berg, MdB zu den Maßnahmen der Bundesregierung in Bezug auf die fortgesetzte Sperrung der Schleuse Zaaren: https://mdb.anke.domscheit-berg.de/2019/04/schriftliche-frage-vom-29-maerz-2019/
* IHK Potsdam zu erwarteten Schäden https://www.ihk-potsdam.de/servicemarken/PRESSE/STARTSEITENBEITRAeGE/schleusensperrung-in-zaaren/4362250