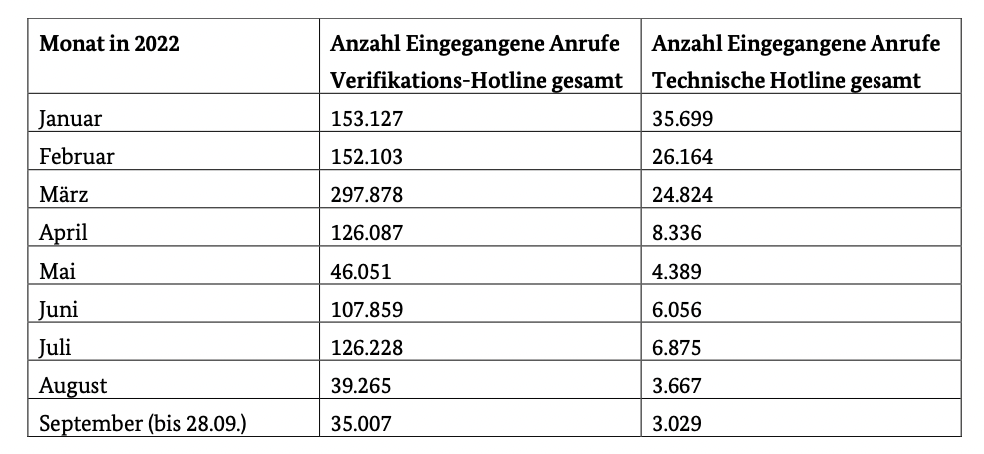Meine letzten Fragen an die EU-Kommission
Der Digitalausschuss hatte sich in seiner letzten Sitzung der Legislaturperiode am 29. Januar 2025 auf meine Anregung ein enorm wichiges Thema vorgenommen, nämlich die Durchsetzung des Digital Services Act und des europäischen Rechts sowie Maßnahmen zum Schutz vor Desinformation und der Integrität von Wahlen. Die eingeladenen Unternehmen Meta, TikTok und X haben die Teilnahme kurzfristig verweigert, aber zumindest stand die Generaldirektorin der EU-Kommission für Kommunikationsnetzwerke, Inhalte und Technologie, Renate Nikolay, dem Ausschuss für Fragen zur Verfügung.
Leider stand die Sitzung ganz unter dem Eindruck des Ergebnisses der Abstimmung über den 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz, auch bekannt als Fall der Brandmauer. Die Sitzung wurde während der Befraung von Frau Nicolay für spontane Fraktionssitzungen abgebrochen, weshalb ich meine Fragen vor Ort nicht stellen konnte. Ich hatte nur die Möglichkeit, diese im Nachgang schriftlich einzureichen. Die Antworten stelle ich hier online:
Frage 1:
Da immer mehr globale digitale Plattformen in der Hand von Tech Milliardären dem Rechtsruck unterliegen, vulnerable Gruppen weniger schützen und Desinformationen hemmungsloser verbreiten wollen, wäre es schön, wenn die EU eine gemeinwohlorientierte Alternative dafür schafft, z.B. auf der Basis des Fediverse oder von BlueSky, wie die freeourfeeds Initiative gerade plant. Eine Plattform, die wirklich werbefrei ist, keiner individuellen Agenda dient, sondern open source, interoperabel, transparent, mit hoher Nutzerautonomie und ohne Einflussnahme durch Staaten oder Privatpersonen, die einfach nur die Vernetzung und Kommunikation ermöglicht, ohne unsere Daten zu verkaufen oder uns zu manipulieren, ist eine riesige Marktlücke. Sie könnte zur sozialen Infrastruktur der digitalen Gesellschaft werden und verhindern, dass digitale Monopole in Milliardärshand unsere Demokratien ihrem Profitinteresse opfern. Gibt es dazu eine Debatte in der EUKOM und denkt man über Regulierung existierender Plattformen hinaus?
Antwort der EU-Kommission vom 14. Februar 2025:
„Die Kommission fördert alternative digitale Plattformen seit mehreren Jahren. Im Rahmen der Initiative „Next Generation Internet“ (NGI) inklusive Finanzierung durch das Programm Horizon Europe hat die Kommission dezentrale soziale Medienplattformen „made in Europe“ und „Fediverse“-Initiativen unterstützt. Mehr als 40 Projekte wurden bereits finanziert, darunter Mastodon für Mikroblogging, aber auch Alternativen zu YouTube (Peertube) und Instagram (pixelfed). Darüber hinaus existiert seit 2024 ein Pilotprojekt zum Fediverse („Fediversity“), um alternative dezentrale und Open-Source-Lösungen mit zugehöriger Infrastruktur und Unterstützung bereitzustellen.“
Frage 2:
Sehr große digitale Kommunikationsplattformen müssen laut DSA der EU-KOM strukturelle Risiken und Maßnahmen zu ihrer Reduzierung melden. Betrachtet die EU-KOM den Umstand, dass eine VLOP einem Milliardär gehört, der diese Plattform mitsamt ihren Algos zur einseitigen u massenhaften Beeinflussung der pol. Meinungsbildung bei Wahlen in einem EU Land einsetzen kann, einerseits als strukturelles Risiko nach DSA, das andererseits im Fall von Elon Musk nicht im Sinne des DSA minimiert, sondern aktuell maximiert wird – zB durch Verbreitung von Desinformation und massenhafter Werbung für Frau Weidel und ihre rechtsextreme AfD und gibt es diesbezüglich Ermittlungen?
Antwort der EU-Kommission vom 14. Februar 2025:
„Der spezifische Fall, den das Mitglied des Bundestags in dieser Frage beschreibt, ist im DSA nicht in dieser Detailtiefe geregelt. Daher ist eine fallbezogene Bewertung auf Basis der konkreten Fakten und Umstände jedes Einzelfalls erforderlich. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu betonen, dass die Kommission bereits am 18. Dezember 2023 ein Verfahren gegen X wegen Risiken negativer Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse eingeleitet hat. Zudem wurden am 17. Januar zusätzliche Ermittlungsmaßnahmen im Hinblick auf die Empfehlungssysteme von X eingeleitet.“
Frage 3:
Können wir uns auf das europäische Wertesystem und die geltende Regulierung verlassen, auch wenn Trump seine Drohungen ernst meint, Zölle zu erhöhen oder die NATO hängen zu lassen, falls der DSA seine Zähne zeigt und US-Tech-Milliardäre für die Risiken ihrer Plattformen bestraft? Und stimmt der Bericht der Financial Times, wonach derzeit eine Überprüfung und Aussetzung von Bußgeldern bezügl. der laufenden DMA-Ermittlungen gegen Apple, Meta & Co laufe, wg Druck aus den USA?
Antwort der EU-Kommission vom 14. Februar 2025:
„Die Europäische Kommission handelt unabhängig und wird ihre Arbeit bei der Durchsetzung von DSA und DMA auch weiterhin ausschließlich auf Fakten und Beweisen basieren. Die Durchsetzung des europäischen Rechts erfolgt ausschließlich im Einklang mit den geltenden Verfahren. Alle Untersuchungen laufen ohne Unterbrechung oder Verzögerung. Zu den zitierten Presseberichten der Financial Times können die Kommissionsdienste keine Stellung nehmen.“
Frage 4:
Geht die EU KOM Hinweisen nach, dass es gezielte pushes für bestimmte rechtsgerichtete politische Inhalte auf X vor der Präsidentschafts-Wahl in den USA gab bzw. in Deutschland aktuell gibt, wie es der mutmaßliche Whistleblower „concerned bird“ am 11. Januar 2025 auf seinem Blog behauptete?
Antwort der EU-Kommission vom 14. Februar 2025:
„Zunächst weisen wir auf ein spezielles Whistleblower-Tool für den DSA hin, über das jede Person anonym vertrauliche Dokumente zu möglichen Verstößen gegen den DSA einreichen kann: https://digital-services-act-whistleblower.integrityline.app/ Bezüglich der von einem mutmaßlichen Whistleblower am 11. Januar 2025 geäußerten Behauptungen verfolgt die Kommission alle relevanten Hinweise mit der gebotenen Sorgfalt. Falls belastbare Beweise für Verstöße gegen den DSA oder andere europäische Regeln vorliegen, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.“
Und dann hatte ich noch eine Frage an das BMI:
Correctiv berichtete von ca. 100 dt. sprach. Fake-News-Websiten, die vermutlich für Einflussnahme auf BTW aufgebaut wurden, überwiegend inaktiv sind, aber einige bereits zur Verbreitung von Desinfo genutzt wurden, z.B. Behauptung 1,9 Kenianer kämen nach Abkommen mit Kenia nach DE oder BW mobilisiert 0,5 Mio. Soldaten für Osteuropa Einsatz. KI genutzt für DeepFakes. Verbreitung durch pro-russ. Influencer. Dahinter soll russischen Operation Storm 1516 u ein russ. Geh. Dienst stecken – gleiches Netzwerk verbreitete Desinfo zur US-Wahl. Was unternimmt die BuReg mit welchen Instanzen konkret zur Prüfung u ggf. zur Abschaltung? Was ist der Kenntnisstand?
Antwort des BMI vom 7. Februar 2025:
„Die Einflussoperation „Storm-1516“ ist dem BMI und den nachgeordneten Sicherheitsbehörden bekannt und wird im Rahmen der Analyse von Desinformations- und Einflusskampagnen, auch mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl, bearbeitet. Die bei SIM Networks gehosteten Domains sind nach wie vor online. Die klandestine Verbreitung von Desinformation durch ausländische staatliche Stellen in Deutschland ist grundsätzlich nicht strafbar. Dies erschwert behördliche Anweisungen an deutsche Provider für Abschaltungen, wie hier im Falle von SIM Networks.“