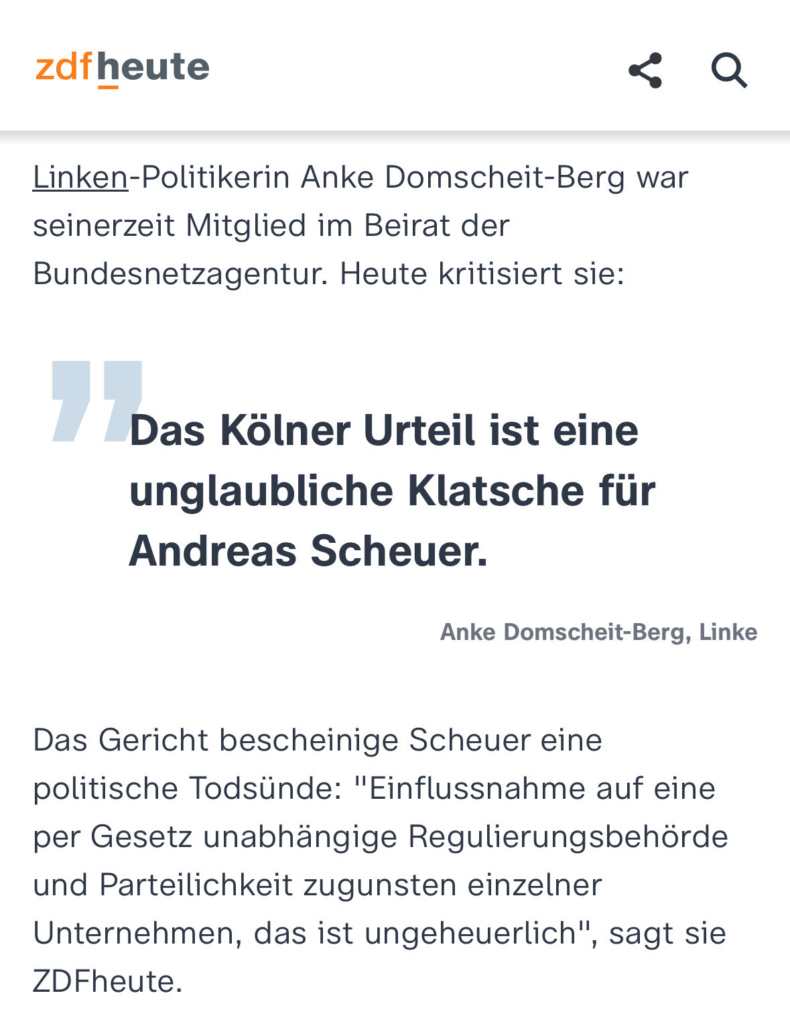Zum vierten Mal seit 2021 erfragte DIE LINKE im Bundestag die Bundesregierung zur Nachhaltigkeit der Bundes-IT und nimmt eine Gesamtbewertung für die ablaufende Legislatur vor. Die ehemalige Ampelregierung war mit hohen Ansprüchen angetreten, schrieb sich Nachhaltigkeit in den Titel des Koalitionsvertrages und versprach nachhaltigere Rechenzentren, 100% Ökostrom bis Ende 2024, Einkauf von IT-Produkten und Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Blauen Engels und die Fortsetzung der Reduktion der Rechenzentren im Rahmen der IT-Konsolidierung des Bundes. In der vorliegenden Kleinen Anfrage beantwortete die Bundesregierung auch Fragen zum erheblichen Einkaufsvolumen des Bundes für IT Produkte und Dienstleistungen, zur Umsetzung des Energieffizienzgesetzes und zum (extrem angestiegenen) Gesamtenergieverbrauch der Bundes-IT. Dazu erklärt Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der LINKEN im Bundestag:
Krachend gescheitert: Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele für die Bundes-IT
Meine vierte Kleine Anfrage zur Nachhaltigkeit der Bundes-IT offenbart eine verheerende Bilanz der scheidenden Bundesregierung, die mit hohen Ansprüchen angetreten war, aber an jeglicher Umsetzung scheiterte. Der Energieverbrauch durch IT ist massiv angestiegen, die unglaubliche Marktmacht des Bundes von fast 10 Milliarden Euro Einkaufsvolumen wurde einfach nicht für die Bevorzugung nachhaltiger IT genutzt und seit 10 Jahren nicht erreichte Ziele wurden plötzlich für überflüssig erklärt, Beschlüsse ignoriert, Zielerreichungen nicht gemessen sowie Zielverfehlungen nicht sanktioniert. Auch die Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes scheint völlig egal, niemand fühlt sich verantwortlich, schon gar nicht das BMWK. Die Ampel ist an der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele krachend gescheitert, aber ich fürchte, in einer Koalition unter Merz wird das Thema Nachhaltigkeit der Digitalisierung schon an der mangelnden Zielsetzung scheitern.
Energieverbrauch der Bundes-IT extrem gestiegen, Ökostrom-Ziel verfehlt
Um 63 GWh stieg der Energieverbrauch der Bundes-IT in 2023. Allein damit könnte man 18.000 Mehrpersonenhaushalte mit Strom versorgen. Insgesamt wurden 2023 sogar 407 GWh verbraten – das würde für sämtliche ca. 116.000 Einwohner Göttingens reichen. Das bereits in 2017 vereinbarte Ziel, unter einem Verbrauch von 350 GWh zu bleiben, wurde damit erstmalig seit 2016 verfehlt, und gleich um 57 GWh. Der Anstieg des IT-Energieverbrauchs um 18 Prozent geht laut Bundesregierung vorwiegend auf den Energiehunger der Rechenzentren zurück. Trotzdem ergab meine Kleine Anfrage: nur jedes 10. RZ des Bundes nutzt ein Energiemanagement und nur ca. 70 Prozent der RZ verwenden 100 Prozent Ökostrom.
Trotz Klimakrise ignorierte die Bundesregierung die eigene Verantwortung und sorgte weder ausreichend für einen geringeren Energieverbrauch, noch für mindestens 100% Ökostrom. Dabei war es ihr erklärtes Ziel, dass bis Ende 2024 alle Liegenschaften des Bundes nur saubere Energie nutzen. Trotzdem werden einige RZ „nicht vor 2028“ und andere sogar erst „spätestens bis 2045“ auf Ökostrom umstellen – das wäre 21 Jahre nach der Deadline! Solche Antworten müssten interne Konsequenzen haben, haben sie aber nicht und hatten sie nie und das ist Teil des Problems.
Chance verpasst: 10 Milliarden Euro Einkaufsmacht des Bundes bei IT ohne Impact
Der Bund könnte allein mit seiner immensen Marktmacht Einfluss darauf nehmen, wie nachhaltig die IT in ganz Deutschland ist, denn bei über 2.000 Vergaben in 2023 gab er fast 10 Mrd Euro für IT-Produkte und Dienstleistungen aus. Aber das passiert einfach nicht, weil es zwar Beschlüsse, Leitfäden und Vorgaben gibt, aber keinerlei Verbindlichkeit, keine Transparenz zur Umsetzung und niemanden, der sich wirklich dafür verantwortlich fühlt. Allein für Software Beschaffung wurden 4,8 Mrd Euro in 2023 ausgegeben. In weiteren 3,7 Milliarden für IT-Dienste sind außerdem Vergaben für Software-Entwicklung enthalten. Laut Umweltbundesamt ist das Ressourceneinsparpotenzial von Software immens, aber trotzdem hat der Bund in dieser Legislatur bei mehr als 1700 vergebenen Software-Entwicklungsaufträgen kein einziges Mal die Einhaltung der Kriterien des Blauen Engel für energieeffiziente Software verlangt oder bei Eigenentwicklungen vergeben, nicht mal das Klima- und das Umweltministerium.
Auch bei keiner der 118 Vergaben von Cloud Dienstleistungen war der Blaue Engel eine Bedingung für den Einkauf. Hier könnte der Markt wirklich mal etwas regeln, aber eben nur, wenn der Bund seine Marktmacht auch nutzt. Ein Ministerium, das Wirtschafts- und Klimathemen vereint, könnte dabei Vorreiter sein, aber im BMWK ignoriert man nicht nur die eigene Marktmacht, sondern auch die Macht der Regulierung. Nach Verabschiedung des abgeschwächten Energieeffizienzgesetzes scheint sich das BMWK nämlich dafür nicht mehr zu interessieren, denn es hat laut Antwort der Bundesregierung auf meine Fragen dazu u.a. „keine Kenntnis“ davon, ob und wie sich Unternehmen oder selbst der Bund daran halten, z.B. durch Beteiligung am RZ-Register.
Die 135 Rechenzentren des Bundes nutzen kaum Abwärme und klimafreundliche Kältemittel
Bei der Senkung der negativen Klimawirkung von Rechenzentren wurde weder bei der Nachnutzung der Abwärme noch bei der Art der Kältemittel eine nennenswerte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Bei Bestands-Rechenzentren ist eine Veränderung nicht einfach und manchmal gar nicht umzusetzen. Aber offensichtlich schöpft der Bund seine Möglichkeiten nicht aus, denn nur jedes 8. Rechenzentrum nutzt einen Teil seiner Abwärme und nur jedes 6. Rechenzentrum setzt klimafreundliche Kältemittel ein und für etwa jedes Dritte RZ wurde nicht einmal eine Antwort auf diese simplen Fragen gegeben.
Fazit zur Betriebskonsolidierung des Bundes: immer mehr statt weniger Rechenzentren
Seit 10 Jahren soll die Anzahl der Rechenzentren des Bundes um 90 Prozent sinken, von 100 RZ in 2015 auf 10 RZ in 2025. Stattdessen zeigen meine Kleinen Anfragen seit Jahren, dass keine Konsolidierung stattfindet. Für Ende 2024 gab der Bund 135 RZ an und noch in diesem Jahr sollen daraus sogar 139 werden, bevor es irgendwann weniger werden sollen. In 2028 sollen es 123 RZ sein, also immer noch 23 Prozent mehr, als bei Beginn der Konsolidierung, statt 90 Prozent weniger. Noch 2023 wurde mir im Digitalausschuss das alte Ziel der Konsolidierung auf künftig nur noch 10 RZ als weiterhin gültig versichert. Da war sogar von nur noch 3 Master-RZ die Rede. Aber nun kapituliert der Bund einfach komplett und erklärt nach einem Jahrzehnt Fehlentwicklung, dass die Anzahl der RZ ganz egal und ihre Reduktion kein Ziel mehr sei, man schaue jetzt nur noch auf die Konsolidierbarkeit von Anwendungen. Da die IT-Konsolidierung des Bundes eines der teuersten IT-Projekte mit einem Volumen von über 3 Milliarden Euro ist, ist diese Bankrotterklärung nicht nur peinlich, sondern auch ein unfassbar laxer Umgang mit Steuergeldern. Der Bundesrechnungshof kritisiert die mangelnde Umsetzung schon seit Jahren völlig zu Recht, aber leider auch völlig ohne Wirkung.
Kaum Transparenz, ein (noch?) disfunktionales Berichtswesen, fehlende Tools als Ausrede
Ich glaube an den Grundsatz „You get what you measure“, denn wenn man Ziele nicht messbar definiert und den Grad ihrer Erreichung nicht erhebt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sie verfehlt. Deshalb habe ich das Fehlen messbarer Ziele bei der Digitalstrategie von Anfang an kritisiert. Auch die Umsetzungsschwäche bei der Nachhaltigkeit der Digitalisierung hat viel mit vagen Zielen und/oder mangelnder Transparenz zu tun. Wieder war eine besonders häufige Antwort auf meine Fragen „Keine Angabe“ oder „keine Kenntnis“. Man kann nur spekulieren, ob das an Unfähigkeit oder am Unwillen liegt, diese Daten bereitzustellen. Manchmal ist die Ursache klar, wie bei der grottigen Ressourceneffizienz von Websites des Bundes. Den Klima-Impact seiner laut Antwort der Bundesregierung 2.160 Websiten ignoriert der Bund nämlich deshalb komplett, weil man die existierenden Tools zur Messung ihrer Ressourceneffizienz nicht gut genug findet. Dabei könnte der Bund selbst Tools entwickeln und zertifizieren lassen. Alternativ könnten eigene Vorgaben des Bundes dafür sorgen, dass Websiten von BMI und BMWK nicht mehr bei Messwerkzeugen wie websitecarbon.com schlechter abschneiden, als über 90 Prozent aller Websiten weltweit.
Immerhin könnte es künftig zuverlässigere Daten geben, denn ein neues Berichtswesen für die Nachhaltigkeit der RZ ist geplant. Ein Tool dafür soll irgendwann in 2025 entwickelt werden. Allerdings steht und fällt der Erfolg damit, ob die Anwendung verbindlich ist und sich die Behörden daranhalten. Vorgaben gibt es jetzt auch schon viele, sie werden nur leider folgenlos ignoriert. Der Gipfel ist jedoch der Umgang des Bundes mit verfehlten Zielen. Denn dann wird die Berichterstattung einfach verschleppt, wie beim Monitoringbericht zum Maßnahmeprogramm Nachhaltigkeit, der für 2023 immer noch nicht vorgelegt wurde und für 2024 „wegen Evaluierung“ gar nicht mehr geplant wird. Oder das Ziel wird insgesamt für obsolet erklärt, wie bei der Konsolidierung der Anzahl der Rechenzentren. Mehr Bankrotterklärung geht eigentlich gar nicht.
Antwort der Bundesregierung
Antwortschreiben der Bundesregierung im Original (geschwärzt)
Anlage 1 (Anzahl RZ 2022-2028, Eigenbetrieb ja/nein)
Anlage 2 (Einhaltung der Kriterien des Blauen Engels durch RZ des Bundes)
Anlage 3 (Gesamtenergieverbrauch der RZ, Bezug von Ökostrom)
Anlage 4 (verwendete Kältemittel in RZ, geplante Umrüstung)
Anlage 5 (Abwärmenutzung durch RZ, Energy Reuse Factor, geplante Umstellung)
Anlage 6 (Nachhaltigkeit bei Verträgen für Rechenzentrums-Dienstleistungen)
Anlage 7 (Liste der Website-Adressen des Bundes)
Tabellengrafiken (Auswertung der Anlagen)
Umfassende Analyse der Antwort der Bundesregierung mit Zahlen, Daten, Fakten
Weiterführende Informationen
Kleine Anfrage Nachhaltigkeit der Bundes-IT 2023
Kleine Anfrage Nachhaltigkeit der Bundes-IT 2022
Kleine Anfrage Nachhaltigkeit der Bundes-IT 2021
Schriftliche Frage zur Anzahl Entwicklungsaufträge für Software 2021-2024
Kritik des Bundesrechnungshof an der IT Konsolidierung des Bundes
Mein Talk auf dem 37C3-Kongress „Klimafreundliche Digitalisierung – Koalitionsvertrag versus Wirklichkeit“, 2023