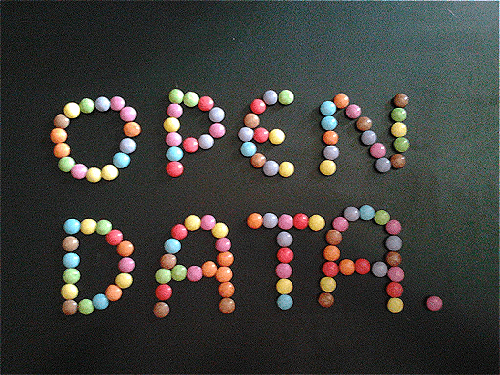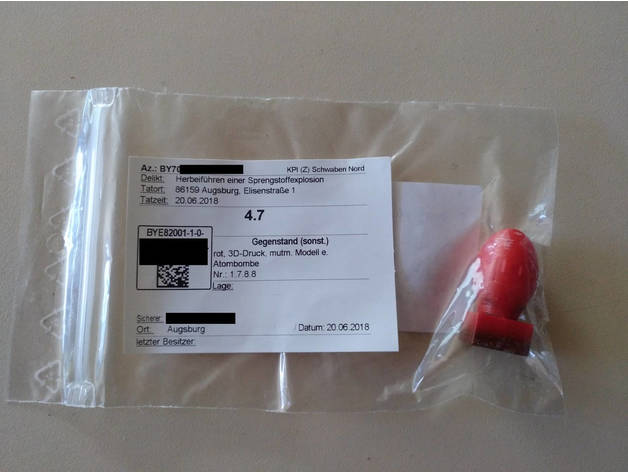In der vergangenen Woche war ich zum ersten Mal auf einer Ausschussreise im Ausland unterwegs. Es ging für drei sehr voll gepackte Tage nach Schweden und nach Dänemark, um von unseren nordischen Nachbarn zu lernen, wie sie ihren beneidenswerten Status Quo sowohl beim Breitbandausbau als auch beim eGovernment erreicht haben. Am Montag morgen ging es zuerst zur Firma Ericsson, die von ihrer Kooperation mit Fraunhofer berichteten und vor allem über den 5G-Ausbau sprachen. Mit BMW und der Deutschen Bahn hat Ericsson auch ein Testfeld für ein 5G-Netz an der Autobahn A9 bei der Bundesnetzagentur beantragt.
Ein solches Netz ist notwendig, um autonome Autos fahren lassen zu können. Einige der Projekte, die man uns vorstellte, waren eher unerwartet, zum Beispiel „Vernetzte Mangrovenwälder“, in denen Sensoren über den Wasserstand und die Nährstoffversorgung Daten sammeln und versenden, aber auch Mobiltelefone an Bäumen befestigt sind, auf denen eine Erkennungssoftware für das Geräusch von Motorsägen installiert ist. Werden Motorsägengeräusche erkannt, informiert das Handy von allein die zuständigen Stellen. Mit diesen Maßnahmen wurden Aufforstungsinitiativen erfolgreicher und konnten Ökosysteme erhalten werden.
Noch bei Ericsson stieß Staatssekretär Alf Karlsson zu uns, der für das Thema Digitalisierung zuständig ist. Er berichtete von den Plänen seiner Regierung, in den nächsten 24 Monaten für mindestens 95 Prozent der Haushalte mindestens 100Mbit/s schnelles Internet bereitzustellen, 2025 soll es für mindestens 98 Prozent der Haushalte mindestens 1GB/s Breitband geben. Anders als in Deutschland, wo sogar schon der EU-Rechnungshof einschätzt, dass auch die neuen Breitbandziele nicht erreichbar sein werden, sind die Ziele in Schweden realistisch, denn der Status Quo ist ein ganz anderer als bei uns. Der Industrieverband der ITK-Industrie in Schweden zeigte uns später stolz eine Landkarte von Schweden, die uns deutsche Delegation staunend und sprachlos ließ. Das langgestreckte Land war dort überwiegend hellgrün eingefärbt, einige gelbe und sehr wenige rote Flecken und Punkte waren aber auch zu sehen. In der oberen Hälfte wohnen nur zehn Prozent der Bevölkerung, wurde uns erklärt. Aber auch diese dünn besiedelte Region war überwiegend hellgrün. Dort wo es grün ist, hieß es, haben 90 Prozent der Bevölkerung 1000 MBit/s schnelles Internet.
Die ganze deutsche Delegation hat sehr betreten geguckt, und wir alle beneideten Schweden. Dort wird dezentraler und überwiegend durch Kommunen selbst ausgebaut, die ihre eigenen Glasfasernetze besitzen und – meist über die Stadtwerke – profitabel betreiben. Der Wettbewerb ist aber sogar stärker als bei uns, nur findet er auf der Ebene der Diensteanbieter statt, nicht auf der Ebene der verbuddelten Infrastruktur. Ein Wettbewerb um verlegte Abwasserrohre macht ja auch keinen Sinn, denn wie Glasfaserkabel sind Abwasseranbindungen ein natürliches Monopol, weil es jeder braucht, aber nur einmal. In Schweden gibt es ein Breitbandforum, in dem Städte, Anbieter, betroffene Behörden, aber auch Initiativen an einem Tisch sitzen, um gemeinsam pragmatisch Probleme beim Breitbandausbau zu lösen. So eine Art Runder Tisch für den Breitbandausbau würde ich mir auch in Deutschland und vor allem auch in Brandenburg wünschen, denn ich weiß, dass es oft hohe bürokratische Hürden gibt, schlicht weil zu viele Behörden an einer Glasfaserstrecke involviert werden müssen – von unteren und oberen Wasserbehörden, über Forstbehörden, Straßenbehörden oder Naturparkbehörden bis hin zu Städten und Gemeinden oder auch Großbauern, deren Acker auf der Strecke liegt. In jeder der 21 Regionen gibt es einen Breitbandkoordinator, der von der Bundesregierung bezahlt, aber von der Regionalregierung angestellt wird. Sie sind die Kontaktstellen zum Breitbandforum und untereinander sehr gut vernetzt. Sie tauschen seit Jahren Erfolgsrezepte aus, das macht sich bemerkbar.
In Schweden spielt der Staat generell eine starke Rolle, er übernimmt häufiger die Daseinsvorsorge und legt häufiger einen Fokus auf die Gemeinwohlorientierung. Das wurde auch offensichtlich, als der Staatssekretär die Landesstrategie zum Einsatz von künstlicher Intelligenz besprach. Sie ist noch nicht fertig, aber es wurde bereits beschlossen, dass der Schwerpunkt darauf liegen soll, künstliche Intelligenz im Sinne des Gemeinwohls zu nutzen, in Feldern der Bildung, Wohlfahrt, im Gesundheitswesen, bei der Bereitstellung von Wohnraum, für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und die Förderung der Demokratie. Ich bin sehr gespannt, auf welche konkreten Anwendungen die Schweden noch kommen werden!
Einen weiteren Unterschied haben wir bei der schwedischen Zentralbank kennengelernt, denn zu unserer Überraschung zeigte man uns Statistiken nach denen das Zahlen mit Bargeld langsam aber sicher in Schweden ausstirbt. Dort wird viel mit Karte bezahlt oder mit einer App, die Swish heißt und das sofortige Überweisen auch kleiner Summen von einem Menschen an einen anderen Menschen per Handy ermöglicht. Selbst Obdachlose halten ihr Handy in die Höhe, um eine kleine Spende per Swish zu erhalten. Das System ist an die Banken angebunden, kostet keine Extragebühren, ist sicher, aber gleichzeitig kinderleicht. Weil es so bequem und einfach ist, belastet sich kaum noch jemand mit Bargeld. Weil damit das Zentralbankgeld aus dem Alltagszahlungsverkehr verschwindet, denkt die Zentralbank darüber nach, eine elektronische Währung selbst auf den Markt zu bringen, die e-Krona. Ihre schon sehr konkreten Pläne dazu finden weltweit Beachtung.
Bei unserem Besuch des schwedischen ITK- Industrieverbandes wurden auch Probleme angesprochen: die Gefährdung der Demokratie und der Aufschwung rechtsextremer Bewegungen u. a. durch Polarisierungen, die durch das Internet erleichtert werden, den flächendeckenden Fachkräftemangel im Bereich Digitalisierung, eine fehlende ganzheitliche Vision für das Schweden der Zukunft und eine Bildung, die der Zeit hinterherhinkt, weil sie in den Schulen nicht adäquat ist, aber vor allem, weil sie kein lebenslanges Lernen ermöglicht, immer dann und dort, wo es gebraucht wird. All diese Probleme haben wir in Deutschland ganz genauso. Über einige sprachen wir beim Treffen mit schwedischen Abgeordneten, die aus dem Ausschuss Verkehr und Kommunikation sowie Ausschuss für Industrie und Handel stammten. Einen Digitalausschuss wie in Deutschland gibt es in Schweden nicht. Vom Parlament ging es direkt zum Flughafen – nach 1,5 Tagen Schweden war Kopenhagen in Dänemark unsere nächste Station, aber darüber werde ich in Teil 2 berichten.