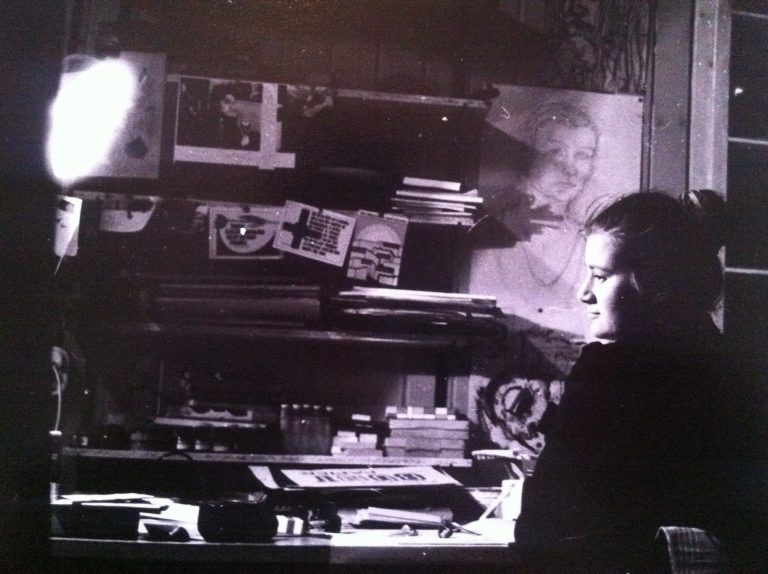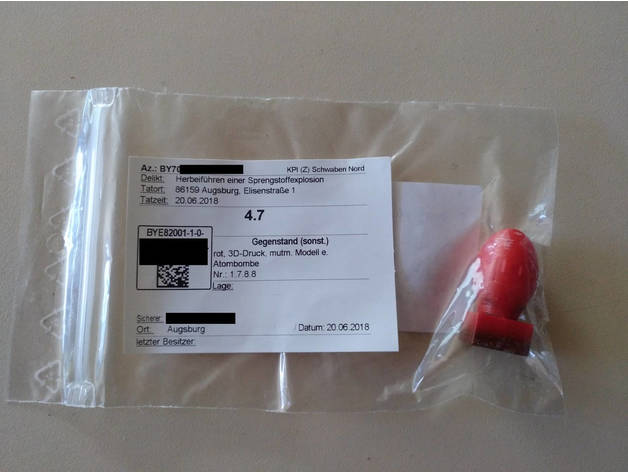Am Montag fand in Potsdam die Klausur der Linksfraktion im Brandenburgischen Landtag zum Thema Digitalisierung statt, an der ich als netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion teilgenommen habe. Einen halben Tag lang haben wir uns dort darüber ausgetauscht, was Digitalisierung von links bedeutet und vor welchen Chancen, Aufgaben und Herausforderungen ein Flächenland wie Brandenburg steht. Ich habe meine Vorstellungen einer Digitalisierung dazu beigetragen, die sich dem Prinzip der Teilhabe und Transparenz verpflichtet.
Schon einmal, vor etwas weniger als 30 Jahren, gab es im Leben der Bürger*innen Brandenburgs eine dramatische Veränderung. Mit der Wende und der Wiedervereinigung fielen in manchen Regionen ganze Industrien weg – oder fast weg (z.B. die Chemieindustrie in Premnitz) und wurden etliche Berufe obsolet, waren häufig Berufserfahrungen und Qualifikationen aus der DDR entwertet. Auch wenn beide Umbrüche, die Wendezeit und die anstehende digitale Revolution, von ihrer Natur her grundverschieden sind, haben sie doch gemeinsam, dass schnelle und umfassende Veränderungen häufig mit Unsicherheit über die Zukunft verbunden sind und daher auch Angst erzeugen und dass diese Angst um die eigene Existenz Menschen in die Arme von Demagogen treiben kann, deren Ziel die Spaltung und Ausgrenzung ist, nicht aber die Solidarität und die Förderung des Gemeinwohls. Es sollte daher Aufgabe der Linken sein, Zukunftsängste abzubauen und sich dafür einzusetzen, dass die digitale Revolution ohne soziale Härten abläuft, wie wir sie nach der Wiedervereinigung im Osten erlebt haben.
Mit der Studie „Arbeit 4.0 in Brandenburg“ hat die Landesregierung ergründet, was Digitalisierung konkret für Betriebe im Land bedeuten kann und was dies für die Beschäftigten heißen wird. Auf der Basis von 1050 befragten Unternehmen zeichnet sich ein sehr differenziertes Bild, bei dem in den nächsten Jahren sowohl Arbeitsplätze wegfallen werden als auch neue geschaffen werden. Zumindest in den nächsten Jahren rechnen die Brandenburger Unternehmen nicht mit großen Arbeitsplatzverlusten – langfristig kann das natürlich ganz anders aussehen und Politik muss sich um beides kümmern, um mittelfristige und um langfristige Herausforderungen. Zu den kurz- und mittelfristigen Herausforderungen gehört, dass ohne Frage ein hoher Anteil an Arbeitsplätzen in der einen oder anderen Form von der Digitalisierung betroffen ist oder betroffen sein wird und das dies in den allermeisten Fällen bedeutet, dass sich die Qualifikationsprofile verändern, also die Angebote und Rahmenbedingungen für Weiterbildung und Qualifizierung deutlich erweitert werden müssen.
In Kürze soll eine Langfassung der Studie veröffentlicht werden, die weitere Detailinformationen über den Stand der Digitalisierung in der brandenburgischen Wirtschaft enthält. In der Klausur kam auch die Digitalisierungsstrategie der Landesregierung zur Diskussion, die im Dezember vom Kabinett veröffentlicht wird. Mehr als 200 Maßnahmen aus sieben Handlungsfeldern wird sie voraussichtlich enthalten. Ich habe die Klausur genutzt, um meine eigenen Vorstellungen zu vermitteln, einen starken Fokus auf das Thema Bildung – von beruflicher Bildung bis zur Schulbildung, die Notwendigkeit guter online Angebote für Verwaltungsdienstleistungen – inklusive Behördenbus, der wöchentlich Dörfer und Kleinstädte anfährt, wie man das von Bäcker- und Fleischerbussen kennt. Viele Fahrten in weit entfernte Behörden sollten überflüssig werden, weil man die eigenen Anliegen einfach online oder über den Behördenbus erledigen kann. Digitalisierung muss dem Gemeinwohl dienen, und bei bürgerfreundlichen Diensten liegt der Nutzen auf der Hand. Gleiches gilt für innovative Gesundheitskonzepte, wie Schwester Agnes Modelle, bei denen Gemeindeschwestern (oder -pfleger) Ärzte im ländlichen Raum entlasten und über mobile Geräte direkt beim Hausbesuch Gesundheitsdaten erheben und über Ärzte analysieren lassen können. Vielen Patienten kann das Wege und Wartezeiten in Arztpraxen ersparen und gleichzeitig sicherstellen, dass nötige Gesundheitsleistungen auch rechtzeitig wahrgenommen werden.
Alles das braucht natürlich eine gute und flächendeckende Infrastruktur, für die in erster Linie – aber nicht nur – der Bund zuständig ist. Als Beiratsmitglied der Bundesnetzagentur setze ich mich aktuell sehr dafür ein, dass die neue Generation Mobilfunknetz (5G) auch den ländlichen Raum schnell und flächendeckend erreicht und Regulierung dafür sorgt, dass nicht nur ein Netz für Reiche dabei herauskommt. Funklöcher und langsames Internet gehören nicht in eine digitale Gesellschaft.
Kurz gefaßt, kann man linke Digitalisierungspolitik immer wieder daran festmachen, dass sie dem Gemeinwohl dient bzw. dienen muss. Das bedeutet Teilhabe statt Ausgrenzung, es bedeutet Einklang mit Datenschutz und nicht Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern, es bedeutet Offenheit und Transparenz – zum Beispiel Offenheit von Verwaltungshandeln (Open Government), Förderungen offener Software (Open Source Software) und auch offene Lehr- und Lernmittel (Open Educational Resources).
Es freut mich, dass die Landesregierung die Öffentlichkeit an der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie beteiligt hat und dass auch mein Feedback willkommen war. Besonders freut mich die Ankündigung, dass es keine Strategie mit hohlen Phrasen werden soll, sondern eine Strategie, die sehr konkrete Maßnahmen enthält, also schon Elemente ihrer Umsetzung. Nur so kann man Vertrauen auf-, Ängste und Unsicherheiten jedoch abbauen. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, auch wenn völlig klar ist, dass im Themenfeld Digitalisierung jede Strategie auch ständig weiterentwickelt werden muss.